weil es gut passt: heute in der rnz: interview mit dem virologen kräusslich aus heidelberg. wer liest, wird merken, dass differenziert betrachtet wird. das ganze ist schön sachlich und einfach genug gehalten, sodass alle es verstehen dürften.
"RNZ-Corona-Podcast
"Man hätte die Impfpflicht früher beenden können"
Uni-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich über die Lehren aus der Corona-Pandemie. Der RNZ-Podcast startete heute vor drei Jahren.
27.03.2023 UPDATE: 27.03.2023 19:00 Uhr 7 Minuten, 9 Sekunden
Von Klaus Welzel
Heidelberg. Am 28. März 2020 ging der erste RNZ-Corona-Podcast mit dem Virologen Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich auf Sendung. In der 108. Folge der erfolgreichen Serie zieht der Dekan der Medizinischen Fakultät an der Universität Heidelberg Bilanz: Was ist gut gelaufen, was sollten wir bei der nächsten Pandemie lieber lassen. Und er bleibt dabei: Das Coronavirus ist vermutlich auf natürliche Weise vom Tier auf den Menschen übergesprungen.
Prof. Kräusslich, heute vor drei Jahren haben wir die erste Folge unseres Corona-Podcasts aufgenommen. Für wie gefährlich halten Sie das Virus noch?
Die Situation ist heute völlig anders als vor drei Jahren. Zum einen, weil sich das Virus verändert hat, zuletzt durch die Omicron-Variante und ihre Subvarianten, die bei weitem nicht so pathogen sind wie das ursprüngliche Virus. Zum anderen haben wir eine völlig andere Immunitätslage in der Bevölkerung. Damals ist ein neues Virus auf eine Bevölkerung getroffen, in der niemand Antikörper oder T-Zellen dagegen hatte. Heute sind die meisten geimpft und/oder haben eine oder mehre Infektionen durchgemacht. Insofern ist es viel weniger gefährlich.
Alle Beschränkungen sind aufgehoben. Wie sieht denn die Lage aus Sicht von Krebspatienten und anderen Schwerkranken aus?
Wir empfehlen weiterhin, dass Personen mit Immunschwäche und schweren Krankheiten, auch Menschen in Pflege- und Altenheimen, den Immunschutz auffrischen; am besten wohl im Herbst vor der nächsten Erkältungssaison. Und wenn das Immunsystem nicht gut reagieren kann – wie in den von Ihnen angesprochene Fällen –, dann sollte man weiterhin Masken nutzen.
Welche Entwicklung bezüglich des Virus’ hat Sie am meisten überrascht?
Wir hatten am Anfang wohl alle nicht damit gerechnet, dass sich das Virus so schnell so stark verändert. Alle Viren verändern sich stetig, aber bei Coronaviren läuft das langsamer als bei anderen RNA- Viren. Insofern hat mich der Immunescape zu so einem frühen Zeitpunkt – und insbesondere die sehr vielen Mutationen bei Omikron – schon überrascht. So lernt man immer wieder dazu; wir hatten eben noch nie zuvor eine so massive Ausbreitung eines Coronavirus.
Bleibt es aus Ihrer Sicht dabei: Das Virus wurde von einem Tier, womöglich dem Marderhund, auf den Menschen übertragen?
Abschließend kann man das nicht beantworten. Ich halte es aber nach wie vor für die wahrscheinlichste Hypothese. Es ist ziemlich klar, dass das Virus ursprünglich aus einer Fledermausart stammt und es wohl einen Zwischenwirt gegeben hat – der Marderhund ist da eine Möglichkeit, aber nicht bewiesen.
Zuletzt gab es ja diese Hypothese …
… das waren sehr gegensätzliche Berichte. Ende Februar hat der FBI Direktor erklärt, seine Behörde sei der Überzeugung, dass das Virus durch einen Laborunfall verbreitet wurde. Das kann man nicht ausschließen, aber es wurde absolut keine neue Evidenz vorgelegt, keine neuen Befunde, sondern lediglich eine Behauptung. Das halte ich für äußerst schädlich. Wir kritisieren stets, wenn im Internet Thesen ohne Daten und Belege verbreitet werden. Deswegen ist es sehr problematisch, wenn eine offizielle Stelle sich genauso verhält.
Und die Gegenthese?
Die beruht auf Untersuchungen des Abwassers aus dem so genannten Seafoodmarkt in Wuhan, wo die initiale Verbreitung begann. Dort hat man in bestimmten Bereichen des Marktes sowohl Erbinformation des Virus als auch von Marderhunden gefunden. Und man weiß, dass Marderhunde mit Sars-Cov-2 infiziert werden können. Das belegt aber nur, dass eine Übertragung über Marderhunde dort möglich war, beweist aber nicht, dass der Marderhund der Zwischenwirt war.
Die Frage nach der Herkunft des Virus dient im Grunde ja nur der Antwort darauf, wie wir uns auf die nächste Pandemie besser vorbereiten können. Welche Antwort haben Sie darauf?
Die Antwort ist nicht wirklich neu. Wir müssen mehr über die Übertragung von Viren von Tieren auf Menschen – also sogenannte Zoonosen – wissen, und mögliche zukünftig wichtige Erreger identifizieren. Daran wird gearbeitet. Es ist klar, dass Tiermärkte und Bereiche, wo verschiedene Tierarten neu und mit Menschen zusammenkommen, ein Risiko darstellen können. Und natürlich bleibt die Informationspolitik insbesondere aus China ein großes Problem, weil vieles nicht bekannt wird. Auch die eben angesprochenen Sequenzen hat ein Forscherteam eher zufällig in einer Datenbank entdeckt. Nachdem darüber berichtet wurde, verschwanden sie ganz schnell wieder aus der Datenbank. Das kann man aber nur politisch angehen, nicht aus der Wissenschaft.
Wenn Sie sagen, Tiermärkte seien ein Risiko: Gilt das vornehmlich für Asien?
Es gilt generell für Tiermärkte, wo viele Tierarten auf engem Raum zusammengedrängt leben, darunter auch Wildtiere.
Und die sollte man verbieten?
Es wird kaum möglich sein, Verbote dieser Art durchzusetzen. Aber wir müssen uns des Risikos bewusst sein. Natürlich sind zoonotische Ereignisse trotzdem sehr selten, weil Virus und neuer Wirt zufällig passen müssen, aber wir haben ja gesehen, was passieren kann, wenn es dann doch auftritt.
Der Beruf des Virologen war zumindest während der ersten zwei Pandemiejahre äußerst beliebt. Hat sich das auch beim akademischen Nachwuchs bemerkbar gemacht?
Dazu kenne ich keine Zahlen. Bei uns gibt es nicht mehr Bewerbungen, aber das Interesse an Viren hat zugenommen.
Welche besondere Eigenschaft benötigt denn ein Virologe?
Interesse an Viren! Begeisterung zur Erforschung winziger Erreger, die man kaum sehen kann, die aber erstaunliche Auswirkungen haben und sich in alle möglichen Richtungen entwickeln können. Aber entsprechende Begeisterung für sein Thema braucht man natürlich genauso bei anderen Berufen.
Sie konnten sich während unserer über 100 Folgen nie so richtig dem Ruf nach einer allgemeinen Impfpflicht anschließen. Hat Ihnen das auch innerhalb ihrer Kollegen Kritik eingebracht?
Nein, da bestand im Grunde Konsens. Die Diskussion über eine Impfpflicht begann zu einer Zeit, als noch vielfach geglaubt wurde, man könne das Virus komplett eindämmen. Als die Impflicht dann für Pflegeeinrichtungen beschlossen wurde, war das bereits sehr fraglich. Und als es im Bundestag um die allgemeine Impfpflicht ging, war längst klar, dass es keine sogenannte Herdenimmunität geben wird.
Das quasi Berufsverbot für Pflegedienstleistende trug zudem zur Spaltung der Gesellschaft bei. Gibt es da Ihrer Meinung nach wieder etwas gut zu machen?
Man sollte daraus vor allem lernen, Beschlüsse schneller zu ändern und gegebenenfalls auch rückgängig zu machen, wenn sich die Situation und unser Wissen ändern. Man hätte die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen früher beenden können – ganz klar.
In letzter Zeit wird vermehrt über Impfschäden diskutiert, woran Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit seiner unglücklichen Art der Kommunikation nicht ganz unschuldig ist. Wo liegt denn da die Quote bei den bisher erfassten Impfschäden?
Die Zahl der erfassten, bewiesenen und bestätigten Impfschäden ist sehr gering. In der Darstellung problematisch ist, dass oft nicht differenziert wird zwischen gemeldeten möglichen Impfnebenwirkungen und belegten Impfschäden. Beim Paul-Ehrlich-Institut werden alle Meldungen registriert, auch solche, die nichts mit der Impfung zu tun haben, oder nach kurzer Zeit vergehen; da liegt die Quote bei ca. 1 in 5-10.000. Echte Impfschäden sind dagegen sehr selten, aber es gibt sie. Bekannt sind die Hirnvenenthrombosen beim Impfstoff von Astra-Zeneca und die Herzmuskelentzündungen bei mRNA. Insgesamt sind derzeit in Deutschland ungefähr 300 Fälle von Impfschäden bei insgesamt 200 Millionen Impfungen anerkannt.
Etwas über 6000 Anträge gibt es, wobei ein Drittel davon bisher auch bearbeitet und entschieden wurde.
Wenn man das hochrechnet, käme man auf 1000 Impfschäden bei 200 Millionen Impfungen; immer noch eine extrem seltene, aber eben eine vorhandene Nebenwirkung, man muss es ernstnehmen!
Und wie sieht es bei Long Covid aus. Wie viele Patienten leiden darunter?
Da muss man unterscheiden. Es gibt Personen, die Organschäden in der akuten Infektion erleiden, es gibt Personen, bei denen sich die Krankheit länger hinzieht, und bei manchen Patienten gibt es auch nach mehr als zwölf Wochen weiterhin mit der Krankheit zusammenhängende Symptome - dann spricht man eigentlich von Post Covid.
Und wie hoch ist diese Zahl derjenigen, die länger als zwölf Wochen leiden?
Die Ergebnisse der Studien variieren, aber in vielen liegt die Quote bei etwa zehn Prozent, darunter auch viele Personen mit leichteren Symptomen.
Stimmt es eigentlich, dass das Immunsystem bei Menschen mit mehreren Coronainfektionen deutlich schneller altert, beziehungsweise spürbar nachlässt?
Wenn es ausgeprägte Änderungen geben würde, müsste man das angesichts der riesigen Zahl von Infektionen weltweit inzwischen sehr deutlich sehen; das schließt aber nicht aus, dass es solche Fälle gibt. Aber auch hierzu war die Aussage des Bundesgesundheitsministers vor einigen Wochen sehr unglücklich.
Dahinter steckt ja der Grundgedanke, dass jemand nach der dritten, vierten, vielleicht sogar fünf Coronainfektion mehr leidet, als unter der ersten. Kann man das auch nicht sagen?
Langzeitstudien gibt es dazu nicht. Aus den geringen persönlichen Erfahrungen mit Mehrfachinfektionen habe ich jedenfalls keine Hinweise dafür.
Stichwort Verteilungsgerechtigkeit. Die Impfstoffe erreichten viele Menschen vor allem in weniger entwickelten Ländern gar nicht. Gibt es erste Zahlen darüber, ob sich das überhaupt auf die Ausbreitung und die Schwere der Pandemie ausgewirkt hat?
Das ist schwierig zu bestimmen. Eine geringe Impfquote in diesen Ländern, geht ja mit schlechter entwickelten Gesundheitssystemen einher. Insofern gibt es auch wenig Diagnostik und keine guten Daten zu Krankheitslast und Sterbefällen.
Bezogen auf Europa und die USA gibt es ja diesen Daten. Wie sah es da aus?
Dort gab es in den großen Wellen in 2022/21 eine deutliche Übersterblichkeit.
Und wie hoch war sie?
Das Statistische Bundesamt erfasste für 2020/21 eine eindeutige Übersterblichkeit. Im Jahr 2020 waren es ca. 39.000 Todesfälle mehr als im Durchschnitt der Jahre 2016-2019, 2021 ca. 68.000 Todesfälle mehr; besonders zeigte sich dies in der Deltawelle im November und Dezember 2021. Die zusätzlichen Todesfälle sind wohl nicht komplett, aber zum Großteil auf Covid zurückzuführen, insbesondere wenn man bedenkt, dass 2021 die Grippewelle und die dadurch bedingte Sterblichkeit fast komplett ausgefallen ist. In den ersten Monaten 2023 liegt die Sterberate nun wieder im langjährigen Durchschnitt.
Zum Schluss noch ein Wort zu den vielen Verboten. Was hat sich aus Ihrer Sicht bewährt und was sollten wir beim nächsten Mal lieber sein lassen?
Ganz klar: Die Maske hat sich vor allem in der frühen Phase vor der Impfung als sehr wichtig erwiesen. Das gilt auch für andere Atemwegserkrankungen. Ich sehe mit Freude, dass auch jetzt noch viele Personen Masken tragen, wenn sie Symptome einer Erkältung haben; sie wollen andere schützen. Und natürlich dient die Maske dem Selbstschutz. Extrem wichtig war natürlich die Impfung. Auch die Abstandsregeln in Innenräumen in der frühen Phase waren aus meiner Sicht sinnvoll und hilfreich.
Was war weniger sinnvoll?
Nicht sinnvoll waren z.B. Ausgehsperren, Spielplätze im Freien zu schließen, Spaziergänge zu verbieten. Für diesen Erreger hat sich gezeigt, dass auch die Schließung von Schulen und Kindergärten zumindest nach der ersten Welle nicht mehr sinnvoll war, weil der Effekt auf die Ausbreitung die dadurch verursachten Beeinträchtigungen nicht rechtfertigen konnte. Das kann aber bei einem anderen Erreger, der bei Kindern und Jugendlichen schwere Schäden verursacht, anders aussehen. Aber alle Beschränkungen im Freien würde man sicher nicht noch einmal so machen.
Wir hatten uns im Vorfeld des Oktoberfestes darüber unterhalten. Und Sie hatten damals kein gutes Gefühl.
Ich war eigentlich immer der Auffassung, dass man es durchführen kann, es aber einen Anstieg der Infektionen geben würde. Das ist auch so eingetreten. Aber es gab keine starke Belastung des Gesundheitssystems. Natürlich gibt es mehr Infektionen, wenn Menschen im Bierzelt eng zusammensitzen. Aber ein Verbot wäre nur gerechtfertigt, wenn man befürchten muss, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt. Die Entscheidung, ob man sich persönlich einem höheren Risiko der Ansteckung aussetzen will oder nicht, muss dagegen jeder Einzelne für sich treffen.
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Klaus Welzel
Chefredakteur"
Corona Pandemiegeschehen
2062 Beiträge
• Seite 199 von 207 • 1 ... 198, 199, 200 ... 207
ANZEIGE
Corona Pandemiegeschehen
sicherlich kein schlechtes interview.
werde mich jetzt auf jeden fall von volksgruppen, die fledermäuse und marderhunde verspeisen weitestgehend fernhalten. glück muss man haben, dass 3 jahre nach der pandemie und unmittelbar nach der veröffentlichung des fbis, die daten doch kurz hochgeladen, entdeckt, und kurz danach wieder gelöscht wurden. würde mich nicht wundern, dass der server auf einer gecharterten ostseeyacht stand

mir ist das mittlerweile egal ob künstlich oder natürlich, die wahrheit erfährt man eh nicht mehr, ändert auch nichts.
mir geht es einfach um die die krassen fehlentscheidungen die die entwicklung und die lebensqualität von ganz jungen und alten menschen betroffen hat und immer noch betrifft.
wer bei der geburt seines kindes nicht dabei sein durfte oder angehörige einsam sterben lassen musste sieht das ganze eventuell nicht ganz so entspannt - und zwar zu recht.
busgelder werden für eisessen verhängt, kinder vom ordnungsamt gejagt während die politik ein gruppenbild ohne maske macht oder spahn noch das dinner zum spendensammeln abhält.
die impfung war sicher eine gute sache, dass es probleme geben kann ganz normal. dennoch müssen die geschädigten vollwertig anerkannt werden, ich denke es sind deutlich mehr als die 300.
erst recht wenn man die zählweise wie bei den opfern der pandemie, die "an oder mit"
 Corona gestorben sind übernimmt.
Corona gestorben sind übernimmt.
ganz abgesehen von dem sinnlosen geld ausgeben, bei dem sich manche die taschen richtig vollgemacht haben. 500 mio betrug mittlerweile mit testzentren, ich bin mir sicher, das ist noch lange nicht der gesamtbetrag. konnte ja auch keiner ahnen wenn man gesehen hat was für klientel die center betrieben hat... der staat lässt sich wirklich bei vollem bewusststein über den tisch ziehen.
habt ihr wirklich hoffnung, dass es bei einer nächsten pandemie irgendwie besser laufen würde?
werde mich jetzt auf jeden fall von volksgruppen, die fledermäuse und marderhunde verspeisen weitestgehend fernhalten. glück muss man haben, dass 3 jahre nach der pandemie und unmittelbar nach der veröffentlichung des fbis, die daten doch kurz hochgeladen, entdeckt, und kurz danach wieder gelöscht wurden. würde mich nicht wundern, dass der server auf einer gecharterten ostseeyacht stand
mir ist das mittlerweile egal ob künstlich oder natürlich, die wahrheit erfährt man eh nicht mehr, ändert auch nichts.
mir geht es einfach um die die krassen fehlentscheidungen die die entwicklung und die lebensqualität von ganz jungen und alten menschen betroffen hat und immer noch betrifft.
wer bei der geburt seines kindes nicht dabei sein durfte oder angehörige einsam sterben lassen musste sieht das ganze eventuell nicht ganz so entspannt - und zwar zu recht.
busgelder werden für eisessen verhängt, kinder vom ordnungsamt gejagt während die politik ein gruppenbild ohne maske macht oder spahn noch das dinner zum spendensammeln abhält.
die impfung war sicher eine gute sache, dass es probleme geben kann ganz normal. dennoch müssen die geschädigten vollwertig anerkannt werden, ich denke es sind deutlich mehr als die 300.
erst recht wenn man die zählweise wie bei den opfern der pandemie, die "an oder mit"
ganz abgesehen von dem sinnlosen geld ausgeben, bei dem sich manche die taschen richtig vollgemacht haben. 500 mio betrug mittlerweile mit testzentren, ich bin mir sicher, das ist noch lange nicht der gesamtbetrag. konnte ja auch keiner ahnen wenn man gesehen hat was für klientel die center betrieben hat... der staat lässt sich wirklich bei vollem bewusststein über den tisch ziehen.
habt ihr wirklich hoffnung, dass es bei einer nächsten pandemie irgendwie besser laufen würde?
-

highdelberg - Gesperrt
- Beiträge: 5679
- Registriert: 10.05.2005, 11:15
- Wohnort: Heidelberg
- Beim SVW seit: 1992
Corona Pandemiegeschehen
Man hätte jetzt zumindest wichtige Erfahrungen gesammelt um bei der nächsten Pandemie nicht ganz so nackt dazustehen. Ob's hilft weiß ich nicht.
Wenn sich Parteien durchsetzen, die mit aller Gewalt das bewahren wollen, das vor 50 Jahren funktioniert hat, und Euphemismen wie "die schwarze Null" statt dem zutreffenderen Begriff "Investitionsstau" nutzen, dann seh ich schwarz.
Setzen sich Parteien durch, die sich regelmäßig Wissenschaftsfeindlich äußern, die einen sehr flexiblen Umgang mit dem Begriff "Fakten" pflegen, und die nicht nur bewahren wollen, sondern die Uhr am liebsten um 80 Jahre zurückdrehen würden, seh ich noch schwärzer.
Aber kann man auch positiv sehen: es kommen weit weniger Menschen bei der nächsten Pandemie um, wenn das Klima endgültig kippt, und Kriege um Wasser und Nahrungsmittel unausweichlich macht.
Wer das für eine Ideologie hält, dem kann ich, wie auch beim Thema Covid, nur raten sich mit den wissenschaftlichen Fakten zu befassen, die z.b. Exxonmobile schon seit fast 50 Jahren vorliegen.
Wenn sich Parteien durchsetzen, die mit aller Gewalt das bewahren wollen, das vor 50 Jahren funktioniert hat, und Euphemismen wie "die schwarze Null" statt dem zutreffenderen Begriff "Investitionsstau" nutzen, dann seh ich schwarz.
Setzen sich Parteien durch, die sich regelmäßig Wissenschaftsfeindlich äußern, die einen sehr flexiblen Umgang mit dem Begriff "Fakten" pflegen, und die nicht nur bewahren wollen, sondern die Uhr am liebsten um 80 Jahre zurückdrehen würden, seh ich noch schwärzer.
Aber kann man auch positiv sehen: es kommen weit weniger Menschen bei der nächsten Pandemie um, wenn das Klima endgültig kippt, und Kriege um Wasser und Nahrungsmittel unausweichlich macht.
Wer das für eine Ideologie hält, dem kann ich, wie auch beim Thema Covid, nur raten sich mit den wissenschaftlichen Fakten zu befassen, die z.b. Exxonmobile schon seit fast 50 Jahren vorliegen.
Lieber Oberliga als Populismus: Beetz raus!!!
-

Gaddestädtler - Beiträge: 14363
- Registriert: 10.09.2008, 14:30
Corona Pandemiegeschehen
zu dem thema hatte ich vor einigen monaten bereits etwas geschrieben. kam bei "hallogenscher" leider so an als wollte ich umgehend die halbe menschheit vernichten 


-

highdelberg - Gesperrt
- Beiträge: 5679
- Registriert: 10.05.2005, 11:15
- Wohnort: Heidelberg
- Beim SVW seit: 1992
Corona Pandemiegeschehen
Kannst du mich bitte aufklären welches Klientel die Testcenter betrieben hat?
Auferstanden von den Toten
Januar 2018
R.I.P. Geiger
30.08.2017 Never Forget
Januar 2018
R.I.P. Geiger
30.08.2017 Never Forget
-

Tarik - Beiträge: 1695
- Registriert: 16.07.2007, 15:23
- Wohnort: Heidelberg
Corona Pandemiegeschehen
Tarik hat geschrieben:Kannst du mich bitte aufklären welches Klientel die Testcenter betrieben hat?
AFD Politiker z.B.
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/bad-berleburg-afd-politiker-zoz-plant-testzentrum-id234280639.html
-

cahe - Administrator
- Beiträge: 14863
- Registriert: 19.09.2007, 09:25
- Wohnort: Rheinhessen
Corona Pandemiegeschehen
cahe hat geschrieben:Tarik hat geschrieben:Kannst du mich bitte aufklären welches Klientel die Testcenter betrieben hat?
AFD Politiker z.B.
https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/bad-berleburg-afd-politiker-zoz-plant-testzentrum-id234280639.html
dann wundert mich gar nichts mehr.
-
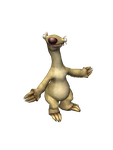
hallogenscher - Beiträge: 5042
- Registriert: 03.10.2008, 08:59
Corona Pandemiegeschehen
Teile der Antwort würden euch wahrscheinlich verunsichern, Tarik.
Als Beispiel der Barbier der den einen Laden von uns gemietet hat.
Als Beispiel der Barbier der den einen Laden von uns gemietet hat.
-

highdelberg - Gesperrt
- Beiträge: 5679
- Registriert: 10.05.2005, 11:15
- Wohnort: Heidelberg
- Beim SVW seit: 1992
Corona Pandemiegeschehen
In der Tat wurden Testcenter gegründet, nur um dort absichtlich falsch abzurechnen. Eine Nationalität dieser Menschen spielt dabei keine Rolle. Es sind auch genug Deutsche dabei.
Oftmals war es halt so, dass ärztliches Personal als diejenigen gemeldet worden waren, die dann persönlich die Tests bei den Leuten gemacht haben, was die Kosten für den Staat für den Test um ein paar Euro je Test erhöht hat. (Fachpersonal ist eben teurer). Dazu kommt, dass auch viele Tests gemeldet worden sind, die nie gemacht worden sind.
Und das hat man relativ früh gemerkt und so haben sich viele Menschen, die aus absolut fachfremden Branchen kommen, ein Testcenter zugelegt.
Voraussetzung ist aber die Aufsicht eines Arztes, der zwar nicht immer anwesend sein muss, aber zumindest das Personal schulen sollte und bei medizinischen Fragen immer erreichbar sein musste. Auch hier gab es Testzentren, die einfach blind irgendwelche Arztnamen aus den Gelben Seiten gezogen haben und diese angegeben haben. In der Regel standen bei denen auf der Webseite keine medizinischen Verantwortlichen, um den Betrug nicht sofort aufliegen zu lassen. (wobei die Angabe aber verpflichtend ist).
https://www.focus.de/politik/staatlich-gefoerderter-massenbetrug-jens-spahn-und-der-milliarden-betrug-so-zockten-clan-kriminelle-und-straftaeter-bei-corona-testzentren-ab_id_131827954.html
Und noch einmal ( @highdelberg: Gut lesen und verstehen!): Die Nationalität spielt dabei keine Rolle. Daher werde ich jede Äußerung in diese Richtung nicht nur löschen, sondern auch gleich eine Mindestsperre von 7 Tage ansetzen. Und wer schonmal 7 Tage zuschauen durfte, wird dann dauerhaft hier gesperrt.
Oftmals war es halt so, dass ärztliches Personal als diejenigen gemeldet worden waren, die dann persönlich die Tests bei den Leuten gemacht haben, was die Kosten für den Staat für den Test um ein paar Euro je Test erhöht hat. (Fachpersonal ist eben teurer). Dazu kommt, dass auch viele Tests gemeldet worden sind, die nie gemacht worden sind.
Und das hat man relativ früh gemerkt und so haben sich viele Menschen, die aus absolut fachfremden Branchen kommen, ein Testcenter zugelegt.
Voraussetzung ist aber die Aufsicht eines Arztes, der zwar nicht immer anwesend sein muss, aber zumindest das Personal schulen sollte und bei medizinischen Fragen immer erreichbar sein musste. Auch hier gab es Testzentren, die einfach blind irgendwelche Arztnamen aus den Gelben Seiten gezogen haben und diese angegeben haben. In der Regel standen bei denen auf der Webseite keine medizinischen Verantwortlichen, um den Betrug nicht sofort aufliegen zu lassen. (wobei die Angabe aber verpflichtend ist).
https://www.focus.de/politik/staatlich-gefoerderter-massenbetrug-jens-spahn-und-der-milliarden-betrug-so-zockten-clan-kriminelle-und-straftaeter-bei-corona-testzentren-ab_id_131827954.html
Und noch einmal ( @highdelberg: Gut lesen und verstehen!): Die Nationalität spielt dabei keine Rolle. Daher werde ich jede Äußerung in diese Richtung nicht nur löschen, sondern auch gleich eine Mindestsperre von 7 Tage ansetzen. Und wer schonmal 7 Tage zuschauen durfte, wird dann dauerhaft hier gesperrt.
Ich respektiere generell das Recht eines jeden Menschen auf freie Meinungsäußerung. Ich nehme dieses Recht aber auch für mich in Anspruch.
-

Markus - Administrator
- Beiträge: 21114
- Registriert: 27.09.2003, 19:00
- Wohnort: Mannheim
- Beim SVW seit: 13.08.1983
2062 Beiträge
• Seite 199 von 207 • 1 ... 198, 199, 200 ... 207
- Anzeige
